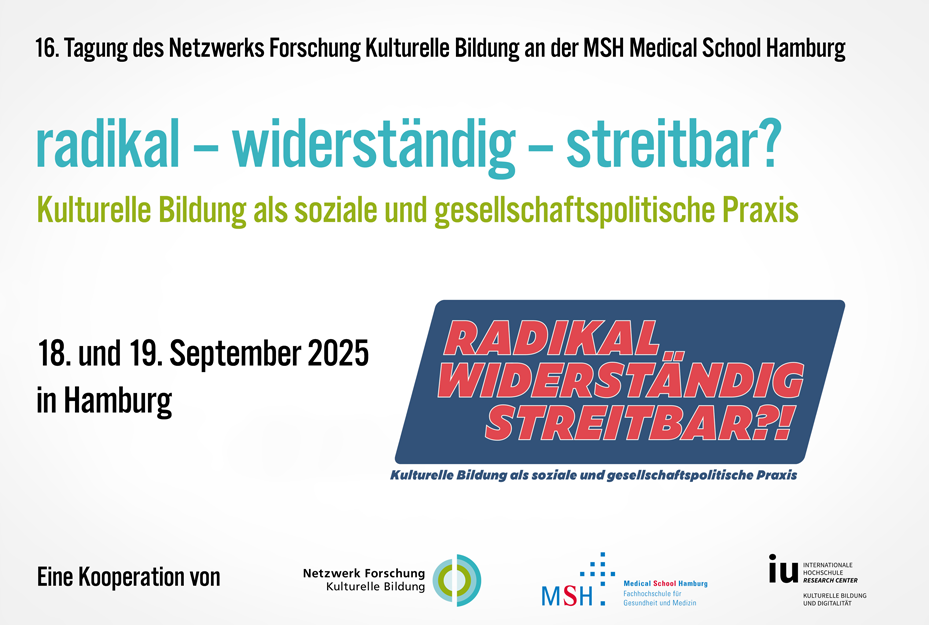radikal – widerständig – streitbar?! Kulturelle Bildung als soziale und gesellschaftspolitische Praxis
16. Tagung des Netzwerks Forschung Kulturelle Bildung an der MSH Medical School Hamburg
18. September bis 19. September 2025
Tagungsbeginn: 18.09.2025, 10:30 Uhr // Tagungsende: 19.09.2025, 15:30 Uhr
Programm und Inhalte
Das Programm zur Tagung finden Sie hier.
Nähere Informationen zu den Beiträgen finden sich im Book of Abstracts.
Wenn Sie sich zum Hintergrund des Tagungsprogramms erkundigen möchten, finden Sie den Call zur Tagung hier.
Organisatorische Informationen
Die 16. Netzwerktagung wurde ausgerichtet und unterstützt von der MSH Medical School Hamburg. Sie wurde gefördert von der Crespo Foundation. Wir danken herzlich!
Die Tagungsidee
Kulturelle Bildung und ästhetische Praxis sind – in Forschung, Lehre und Praxis – unmittelbar in gesellschaftliche Kontexte eingebunden. Sie werden damit sowohl in unmittelbaren Interaktionen als auch in den organisationalen und institutionellen Kontexten des professionellen Handelns sehr konkret mit den vielfältigen Krisen unserer Zeit konfrontiert: Die massiven politischen, ökologischen, ökonomischen, kulturellen und technischen Verwerfungen unserer Zeit führen unter anderem zu Unsicherheiten, Widerständen und Polarisierungen. Mit ihnen verbunden sind Tendenzen der Entdemokratisierung und politischen Radikalisierung sowie die Entstehung sozialer bzw. gewaltsamer Konflikte. Diese Entwicklungen fordern die unterschiedlichen Handlungsfelder Kultureller Bildung, z. B. Soziale Arbeit, Kulturarbeit, Medienbildung, Kinder- und Jugendarbeit, formale Bildung, Soziokultur, Erwachsenenbildung, Kulturgeragogik etc., stark heraus.
Die zu Teilen sehr bedrohlichen Krisen, die sich auf unterschiedlichen Ebenen ereignen, verschieben die Perspektiven und die Diskurse Kultureller Bildung. Sie fordern dazu auf, bisherige Annahmen und Überzeugungen, Theorien und Konzepte progressiv zu hinterfragen und im Hinblick auf veränderte Wege demokratischen Handelns, künstlerisch partizipativer Konzepte und sozialer Inklusion weiterzuentwickeln, um soziale und gesellschaftliche Gestaltungsräume zu eröffnen – im Alltag der Adressat*innen wie im Kontext von Wissenschaft, Lehre und fachlicher Praxis.
Die 16. Tagung des Netzwerks Forschung Kulturelle Bildung fragt: Inwieweit trägt ein radikales, widerständiges und streitbares Selbstverständnis Kultureller Bildung zu einer neuen „Kunst des gesellschaftlichen Wandels“ (Schneidewind 2018) bei? Welche Grundlagen sind dafür notwendig und welche Konsequenzen für kulturelle und ästhetische Bildungspraktiken folgen daraus? Welche Implikationen und Grenzen haben Leitkonzepte Kultureller Bildung für eine aktive Positionierung gegen Diskriminierung, Polarisierung und Radikalisierung? Worin zeigen sich Handlungsverantwortung und Gestaltungspotenziale Kultureller Bildung als Akteur in kulturellen und sozialen Transformationen? Wie radikal, widerständig und streitbar wollen und sollten wir also in unserer künstlerischen, bildenden, ästhetischen und sozialen Forschung, Lehre und Praxis sein?
Grundlegende Perspektivierungen
Aus einer gesellschaftspolitischen Perspektive basiert Kulturelle Bildung auf dem Anspruch einer menschenrechtsbasierten Grundlegung von Wissenschaft, Lehre und Praxis. Diese Grundlegung ist verbunden mit Fragen nach der Ermöglichung gerechter Lebensverhältnisse, die zugleich ein Versprechen auf die subjektive Realisierung von sozialer Teilhabe und politischer Teilnahme zu geben vermögen (Schnurr 2018). Mit dem Ziel, inklusive und diskriminierungssensible Räume der Vergesellschaftung zu eröffnen, richten kulturelle Bildungsakteur*innen ihr Augenmerk entsprechend darauf, soziale Verantwortung und Solidarität durch eine partizipative Praxis zu motivieren. Partizipation wird dabei zunehmend im Kontext einer explizit demokratischen Ausgestaltung ästhetischer und pädagogischer Praxis reflektiert und mit der Etablierung unhintergehbarer Mitbestimmungsrechte verbunden (Doing/Making Democracy). Ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt damit das Ausloten von Schnittstellen zwischen Kultureller Bildung, politischer Bildung und Demokratiebildung (vgl. BMFSFJ 2020/16. KJB). Darüber hinaus steht auch der Demokratiebegriff selbst als eine partizipative Praxis zur Debatte, die sich gesellschaftlich nicht nur als Regierungsform, sondern als soziale und alltäglich erfahrbare Lebensform realisiert (Richter et al. 2016, Rajal et al. 2020) und sich auch darin zeigt, wie sehr Rechte, Sichtbarkeit und Sicherheit von Minderheiten gewährleistet sind. Indem Kulturelle Bildung Artikulations- und Interaktions- sowie Aushandlungsräume zur Verfügung stellt, fungiert sie als politische Plattform. Genutzt werden hierzu unter anderem machtkritische und radikaldemokratische Gegenentwürfe zu herrschenden Strukturen im gesellschaftlichen und politischen System. Dies gelingt, so ein zentrales Paradigma in der Kulturellen Bildung, durch einen emanzipatorischen Bildungsbegriff (Adorno 1971, Zacharias 2001, Zirfas 2015:20ff). Mit diesem Begriff möchten kulturelle Bildungsakteur*innen einerseits zu Widerständigkeit (Fuchs 2018) und andererseits zu konkreter solidarischer und demokratischer Transformation im Alltag der Adressat*innen beitragen. Demokratie und Bildung korrespondieren in diesem Kontext mit einem erweiterten Kulturbegriff (UNESCO 1983). Unter der Prämisse kultureller Vielfalt ringt dieser Kulturbegriff immer wieder um die Anerkennung von unterschiedlichsten ästhetischen und kulturellen Ausdrucksformen für demokratisch-partizipative Bildungs- und Vergesellschaftungsprozesse. Darüber hinaus setzt sich die Praxis Kultureller Bildung dafür ein, mit künstlerischen und ästhetischen Praktiken gesellschaftliche und politische Emanzipationsprozesse konkret erfahrbar, sichtbar und gestaltbar zu machen, ohne die individuelle Autonomie und gemeinschaftliche Interessenartikulationen zu beschädigen bzw. zu instrumentalisieren oder zu vereinnahmen. Insofern ist ein solches Verständnis Kultureller Bildung einem Verständnis politischer Bildung sehr nahe, das diese als kritisches Konzept – in Theorie und Praxis – begreift (Chehata et al. 2023).
Schwerpunkte und Fragestellungen
Wir suchen auf dieser Grundlage nach Beiträgen zu Forschungsergebnissen und Praxiserfahrungen Kultureller Bildung, die progressiv und gern auch provokativ intervenierend zur Diskussion und zur Weiterentwicklung Kultureller Bildung einladen, indem sie
- spezifische Potenziale einer radikalen, widerständigen oder streitbaren Kulturellen Bildung anhand von Schnittstellen oder Spannungsfeldern zu gesellschaftlichen Dimensionen (bspw. Politik, soziale Gemeinschaft, Inklusion, Demokratie, Bildung bzw. Kultur/Künste/Ästhetik, Medien …) vorstellen;
- kritisch fragen, inwiefern bisherige Leitbegriffe in den Handlungsfeldern Kultureller Bildung reformiert werden müssen, um die tiefgreifenden gesellschaftlichen Transformationen aufzugreifen und zu gestalten;
- Positionierungen diskutieren bzw. Positionen einnehmen, welchen gesellschaftspolitischen und sozialen Beitrag Kulturelle Bildung leisten kann und worin sich diese gesellschaftspolitische Verantwortung ausdrückt bzw. welche Instrumentalisierungen damit verbunden sind;
- sich in diesem Kontext auf Prozesse, Haltungen und Bedarfe der unterschiedlichen Akteur*innen/Professionen Kultureller Bildung beziehen, z. B. auf die Lebenssituationen von Teilnehmenden/Adressat*innen, auf die Rolle/Professionen von Forschenden und Lehrenden, auf die Handlungsoptionen der Träger/Praktiker*innen ...;
- adäquate Vorgehensweisen in Forschung, Lehre und Praxis weiterentwickeln und Fallstricken oder weißen Flecken auf die Schliche kommen, die ihrem Handeln innewohnen;
- Praktiken erproben und etablieren, die Öffentlichkeit(en) schaffen bzw. nutzen und dabei machtkritisch, demokratisch-partizipativ, diskriminierungskritisch agieren;
- Rahmenbedingungen und Handlungsdruck für Akteur*innen in Forschung, Lehre und Praxis Kultureller Bildung reflektieren und dabei auch Grenzen, Fehlentwicklungen/Scheitern oder Legitimationszwänge mit entsprechenden Schlussfolgerungen und Konsequenzen aufzeigen.
Genutzte Bezüge
- Adorno, Theodor (1971): Erziehung zur Mündigkeit. Vorträge und Gespräche mit Hellmut Becker 1959 bis 1969. Suhrkamp.
- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ 2020): 16. Kinder- und Jugendbericht. Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter. Bericht über die Lage junger Menschen und die Bestrebungen und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und Stellungnahme der Bundesregierung. Berlin: Bundesministerium für Familie Senioren Frauen und Jugend. Online verfügbar unter https://www.bmfsfj.de/blob/jump/162232/16-kinder-und-jugendbericht-bundestagsdrucksache-data.pdf.
- Chehata, Yasmine/Eis, Andreas/Lösch, Bettina/Schäfer, Stefan/Schmitt, Sophie/Thimmel, Andreas/Trumann, Jana /Wohnig, Alexander (Hrsg.) (2023): Handbuch kritische politische Bildung. Frankfurt am Main.
- Fuchs, Max (2018): Widerständigkeit als Grundprinzip eines selbstbestimmten Lebens. München: kopaed.
- Hahn, Wiebke (2019): Situation als Material. Interventionskunst als politische Aktivität. Berlin: Logos.
- Keuchel, Susanne/Werker, Bünyamin (Hrsg.) (2020): Gesellschaftspolitische Dimensionen der Kulturellen Bildung. Bielefeld: transcript.
- Rajal, Elke/trafo.K,/ Marchart, Oliver/Landkammer, Nora/Maier, Carina (Hrsg.) (2020): Making Democracy – Aushandlungen von Freiheit, Gleichheit und Solidarität im Alltag. Bielefeld: transcript.
- Richter, Elisabeth/Richter, Helmut/Sturzenhecker, Benedikt/Lehmann, Teresa/Schwerthelm, Moritz (2016): Bildung zur Demokratie – Operationalisierung des Demokratiebegriffs für pädagogische Institutionen. In: Knauer, R./Sturzenhecker, B. (Hrsg.): Demokratische Partizipation von Kindern. Weinheim/Basel: Beltz Juventa, S. 106–129.
- Schneidewind, Uwe (2018): Die Große Transformation. Eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels. Frankfurt a.M: S. Fischer Verlag.
- Zacharias, Wolfgang (2001): Kulturpädagogik. Kulturelle Jugendbildung. Eine Einführung. Opladen: Leske und Budrich.
- Zirfas, Jörg (2015): Zur Geschichte der Kulturpädagogik. In: Braun, Tom/Fuchs, Max/Zacharias, Wolfgang (Hrsg.): Theorien der Kulturpädagogik. Weinheim/Basel: Beltz-Juventa, S. 20-43.
Tagungscommittee
Michael Ganß (MSH) • Friederike Gölz (MSH) • Gudrun Sophie Helzel (MSH) • Kerstin Hof (MSH) • Kerstin Hübner (Netzwerk Forschung Kulturelle Bildung) • Jule Korte (IU Internationale Hochschule) • Elisabeth Richter (MSH) • Heidi Salaverria (MSH) • Lea Spahn (Universität Marburg) • Thomas Wilke (Pädagogische Hochschule Ludwigsburg) • Alexander Wohnig (Universität Siegen) • Ivo Züchner (Universität Marburg)
Die 16. Tagung des Netzwerks Forschung Kulturelle Bildung wird von der Medical School Hamburg ausgerichtet. Unterstützt wird sie vom IU Research Center Kulturelle Bildung und Digitalität als Träger der Geschäftsstelle des Netzwerks.